Geheime Glücksspielvereinbarung löst Skandal aus: Einzahlungslimits in Deutschland gelockert
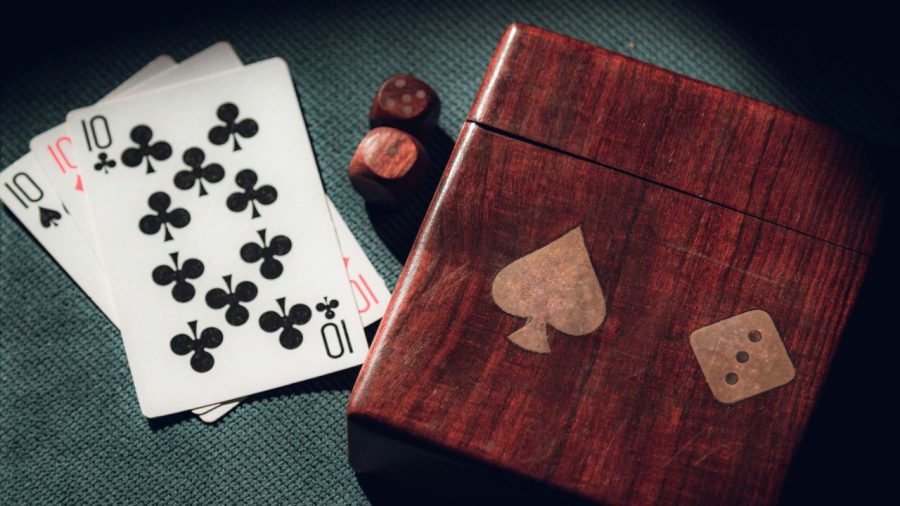
Foto: Andras Joo / unsplash.com
Sind die Würfel zu einer gesetzlichen Neuorientierung gefallen?
Der neue deutsche Glücksspielstaatsvertrag gilt seit mittlerweile vier Jahren und wurde vor allem mit dem Argument eines verschärften Spielerschutzes von den Bundesländern beschlossen. Doch jetzt zeigt sich anhand einer Recherche der Tagesschau, dass bei der Beurteilung der Anbieter offenbar mit zweierlei Maß gemessen wird.
Strenge Vorgaben sollen Spieler schützen
Die strengen Regeln, überwacht von einer eigens dafür ins Leben gerufenen Behörde, gelten nicht für alle gleichermaßen. Ein lange Zeit geheim gehaltener Vergleich zwischen den Bundesländern und der Sportwetten-Branche zeigt auf, dass der gesetzliche Spielerschutz aufgeweicht wurde. Dies scheint allerdings auch damit zusammenzuhängen, dass die im Gesetz formulierten Regeln nicht immer realitätskonform sind.
Ein Beispiel dafür ist laut der Glücksspielbranche das sogenannte 1.000-Euro-Limit für Spieler. Dieses gilt laut Gesetz pro Spieler und Monat. Doch offenbar gilt das Limit nicht für jeden deutschen Spieler. Immerhin lässt der deutsche Glücksspielvertrag ein Schlupfloch offen. Er ermöglicht eine Überschreitung, wenn ein Spieler nachweisen kann, dass auch höhere Einzahlungen keine finanzielle Belastung für ihn darstellen.
Video News
Die Regeln gelten nicht für alle
Das Einzahlungslimit gilt grundsätzlich anbieterübergreifend und damit für alle Formen des Glücksspiels, unabhängig davon, ob es sich um Casinospiele, Poker oder Sportwetten handelt. Doch diese Schutzgrenze lässt sich scheinbar mit einfachen Mitteln umgehen. Wenn die Betreiber zuvor die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ihrer Kunden überprüfen, dann können diese auch deutlich mehr Geld pro Monat bei ihnen verspielen.
Die Überprüfung erfordert allerdings entweder einen Einkommensteuerbescheid oder andere Nachweise eines hohen Einkommens. Doch dieser Weg wurde laut Recherchen der Tagesschau mithilfe eines Vergleichs zwischen der Branche und den deutschen Bundesländern umgangen. Dieser zeigt, dass damit die Vorgaben des Gesetzes umgangen wurden.
Schufa-G-Abfrage statt Einkommensnachweis
Ausgangspunkt dieses Vergleichs war eine Klage der Sportwettenanbieter, die gerichtlich gegen die Bestimmungen des deutschen Glücksspielstaatsvertrages vorgingen. Doch zu einem Urteil kam es erst gar nicht. Die beiden Streitparteien schlossen einen Vergleich. Dieser sieht im Kern vor, dass die Branche eine sogenannte Schufa-G-Abfrage als Vermögensnachweis akzeptieren darf.
Diese Abfrage sollte dazu dienen, Informationen über die Bonität einer Person zu erhalten. Daher wird die Schufa-G-Abfrage hauptsächlich in der Bankenwelt vor der Vergabe von Krediten verwendet. Als Basis für ihre Bewertung zieht die Schufa-G-Abfrage das Zahlungsverhalten der betreffenden Person heran und zieht daraus ihre Schlüsse. Doch damit werden weder das Einkommen noch das Vermögen der betreffenden Person erfasst und bewertet. Demzufolge würde dieser Nachweis nicht den Vorgaben des Gesetzes entsprechen und doch wird er vom Gesetzgeber akzeptiert.
Diese Umgehung ist unter Experten heftig umstritten. Sie verweisen auf eine unvermeidbare Zunahme der Spielsucht. Politische Parteien hingegen kritisieren den Vergleich, wegen seiner vermuteten Verfassungswidrigkeit. Sie fordern, dass dieser vom Höchstgericht überprüft wird.
Evaluierung ist gefragt
Ein Fall wie dieser bietet dem Gesetzgeber die Chance, den deutschen Glücksspielstaatsvertrag nachzuschärfen. Immerhin sieht das Gesetz vor, dass die Regeln ab dem Jahr 2026 evaluiert werden müssen. Das Ergebnis muss im Zuge eines neuerlichen Beschlusses neu fixiert werden, sonst verliert der deutsche Glücksspielstaatsvertrag seine Gültigkeit.
Schon vor Inkrafttreten des Gesetzes kritisierten manche Experten die Ungleichbehandlung zwischen lizenzierten und damit legalen Anbietern und jenen Unternehmen, die auch ohne Lizenz im Internet jederzeit für deutsche Spieler erreichbar sind. Die hohen Steuern und die Einschränkung des Angebots für Online-Casinos würden die lizenzierten Unternehmen benachteiligen. Das würde in der Folge die Spieler nicht verstärkt dazu animieren, nur noch auf legalen Seiten zu spielen. Diese Entwicklung ist in den vergangenen Jahren deutlich zu beobachten. Daher müsste der Gesetzgeber auch in diesem Bereich nachschärfen, wenn er den Schwarzmarkt austrocknen und legale Unternehmen stärken möchte.
Der letzten Beschlussfassung des deutschen Glücksspielstaatsvertrages gingen ohnehin jahrelange Diskussionen voraus. Manche Bundesländer wollten das lange Zeit bestehende Monopol beibehalten, andere wiederum plädierten für eine Marktöffnung. Diese setzten sich schlussendlich durch, auch weil mit der Liberalisierung verstärkte Spielerschutzbestimmungen kommen sollten. Dass jetzt ausgerechnet die Verantwortlichen diese Bestimmungen wieder aufweichen, entbehrt nicht einer gewissen Ironie.
Der Schwarzmarkt ist weiterhin höchst aktiv
Wer effektive Roulette Strategien 2025 entdecken möchte, hat jetzt im Netz eine große Auswahl. Den Spielern stehen schließlich nicht nur die in Deutschland lizenzierten Betreiber von Online-Casinos zur Wahl, sondern auch der Schwarzmarkt. Dieser profitiert durchaus von den strengen Regeln im Glücksspielstaatsvertrag, weil er dem legalen Markt Nachteile verschafft. Damit wurde bisher ein zentrales Ziel des Gesetzes, nämlich den Schwarzmarkt auszutrocknen, nicht erreicht.
Ganz im Gegenteil: Die Einschränkung der Angebote für legale Anbieter eröffnet Unternehmen mit Lizenzen aus anderen EU-Staaten die Möglichkeit einer besseren Vergleichbarkeit. Dieser Vergleich geht oft zuungunsten der legalen Unternehmen aus. Diese setzen zwar im Land immer wieder prominente Gesichter wie Lothar Matthäus oder den ehemaligen Wimbledon-Sieger Boris Becker ein, doch auch diese können das Manko verbotener Spiele im Netz nicht wettmachen.
Die Politiker in den deutschen Bundesländern sind daher jetzt gefordert, eine umfassende und ehrliche Aufarbeitung der ersten Jahre des deutschen Glücksspielstaatsvertrages sicherzustellen. Nur wenn es gelingt, gleiche Bedingungen für alle Marktteilnehmer herzustellen, kann sich der legale heimische Markt so weit entwickeln, dass er die Abwanderung der heimischen Spieler zu ausländischen Betreibern ohne Konzession in Deutschland stoppt. Sollte es jedoch ab 2028 keine Einigung unter den Bundesländern geben, dann würden auch die bestehenden Vorgaben gekippt. Es liegt also in der Hand der Verantwortlichen, das Gesetz entsprechend weiterzuentwickeln.







